Rehan Neziri
Kritische Annäherung an eine deutsch-schweizerische Vergleichsstudie
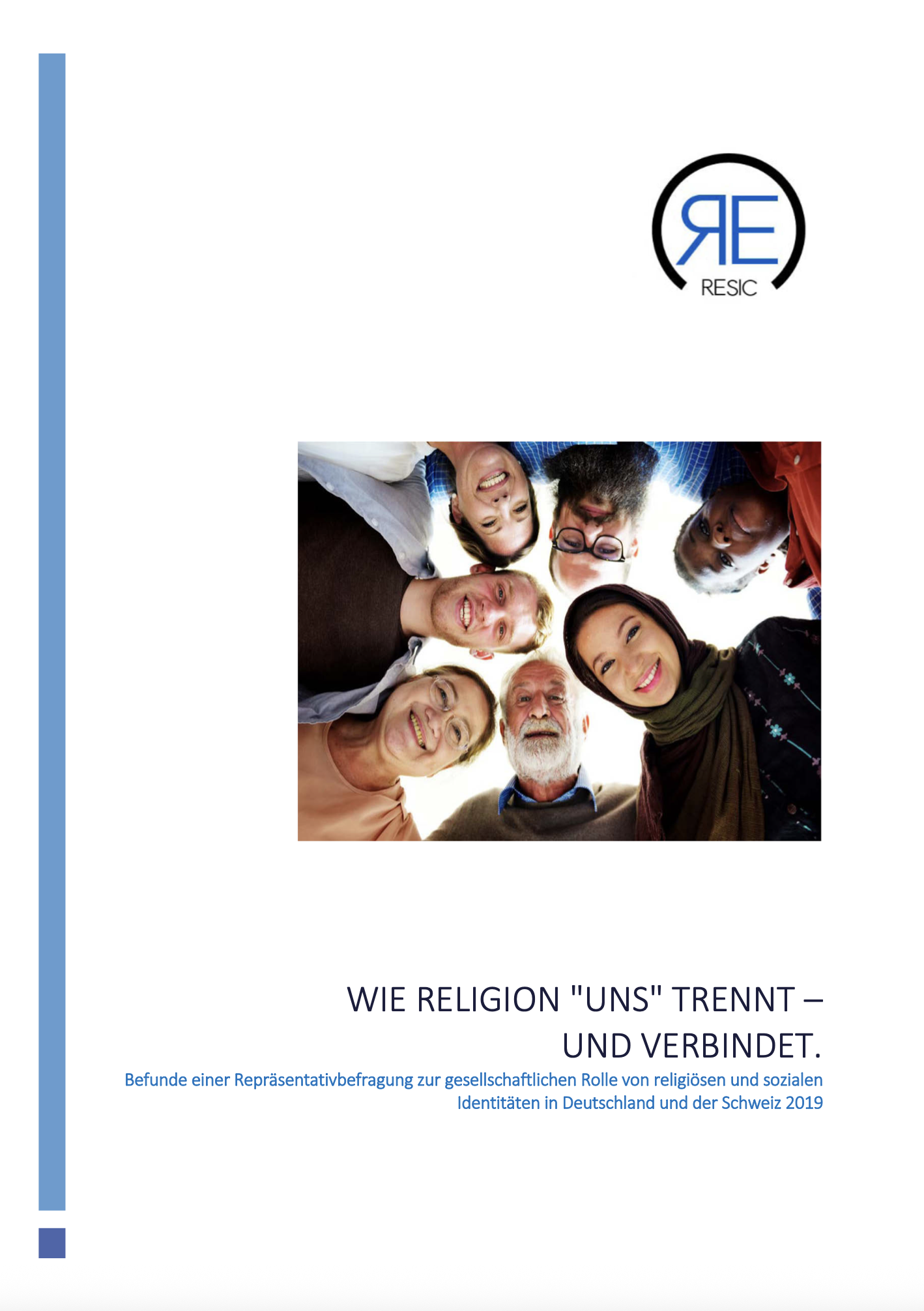 Im Jahr 2019 wurde eine Studie mit dem Titel “Wie Religion ‘uns’ trennt – und verbindet. Befunde einer Repräsentativbefragung zur gesellschaftlichen Rolle von religiösen und sozialen Identitäten in Deutschland und der Schweiz 2019” veröffentlicht. Verfasser der Studie sind Antonius Liedhegener, Gert Pickel, Anastas Odermatt, Alexander Yendell und Yvonne Jaeckel.
Im Jahr 2019 wurde eine Studie mit dem Titel “Wie Religion ‘uns’ trennt – und verbindet. Befunde einer Repräsentativbefragung zur gesellschaftlichen Rolle von religiösen und sozialen Identitäten in Deutschland und der Schweiz 2019” veröffentlicht. Verfasser der Studie sind Antonius Liedhegener, Gert Pickel, Anastas Odermatt, Alexander Yendell und Yvonne Jaeckel.
Die Autorinnen und Autoren dieser Studie gehen von der Beobachtung aus, dass westliche Demokratien gegenwärtig eine Renaissance sozialer Identitäten erleben. Die wohl prominenteste Ausprägung dieses Phänomens sehen sie im Bedeutungszuwachs religiöser Identität im öffentlichen und politischen Leben. In diesem Zusammenhang ist auch eine wachsende öffentliche Verunsicherung im Umgang mit religiöser Zugehörigkeit festzustellen – insbesondere im Hinblick auf Musliminnen und Muslimen. Daraus ergibt sich die zentrale Frage, ob Religion den sozialen Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften schwächt oder stärkt.
An der Umfrage nahmen rund 3.000 Personen aus beiden Ländern im Alter von 16 Jahren aufwärts teil. Die Studie erfasste nicht weniger als 21 soziale Identitätsmerkmale – darunter etwa Familie, Freundes- und Bekanntenkreis, Familienstand, ehrenamtliches Engagement, Geschlecht, Beruf, Nationalität, das Selbstverständnis als Europäer*in, Altersgruppe, Herkunftsort, politische Einstellung, Religion, regionale Herkunft (z. B. Bundesland, Kanton), Zugehörigkeit zur Nachbarschaft oder Wohngegend, Wohnort, Konfession, die Ost-West-Differenz in Deutschland bzw. die Sprachregion in der Schweiz, Schichtzugehörigkeit, wahrgenommene soziale Ungleichheit, Sportfankultur u. a. Diese Identitäten wurden im gesellschaftlichen wie auch religiösen Kontext analysiert.
Ergebnisse der Umfrage
Die zentralen Befunde der Studie – bei der es sich um ein gemeinsames deutsch-schweizerisches Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) mit dem Titel „Konfigurationen religiöser Identitäten im individuellen und kollektiven Leben sowie deren Potenziale für die Zivilgesellschaft (KONID Survey 2019)“ handelt – lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Religion als strukturierendes Element sozialer Identität
Religion stellt – selbst in komplexen Gesellschaften wie Deutschland und der Schweiz – eine prägende und strukturierende Grösse für soziale Identitäten dar. Für viele Menschen ist ihre religiöse oder weltanschauliche Zugehörigkeit ein bedeutsames Element ihres sozialen Selbstverständnisses. In Deutschland bewerten 57 % der Befragten „Religion“ als wichtiges soziales Identitätsmerkmal, in der Schweiz liegt dieser Anteil bei etwa 50 %. Für rund 20 % der deutschen Bevölkerung ist Religion sogar „sehr wichtig“, während dies in der Schweiz auf etwa 13 % zutrifft. Obwohl der Stellenwert religiöser Identität in Deutschland tendenziell höher ausfällt als in der Schweiz, sind die Unterschiede insgesamt moderat. In beiden Ländern zeigt sich eine weitgehend ähnliche Grundstruktur: Gemeinsam ist beiden Gesellschaften eine Polarisierung im Hinblick auf Religion als soziales Identitätsmerkmal – zwischen jenen, die Religion als „sehr wichtig“ einstufen, und jenen (etwa 15 %), für die Religion „überhaupt keine Rolle“ spielt. Gleichwohl zählt Religion in beiden Ländern nicht zu den primären sozialen Identitätskategorien im Selbstbild der Menschen. Vorrangig werden familiäre Zugehörigkeit sowie die Einbindung in Freundes- und Bekanntenkreise genannt. Auffällig ist zudem die hohe Relevanz des freiwilligen und unbezahlten Engagements, das für viele Befragte eine zentrale Rolle in ihrer Selbstwahrnehmung spielt.
2. Ambivalenz religiöser Identität im gesellschaftlichen Zusammenhang
Die häufig gestellte Frage, ob Religion und religiös-weltanschauliche Identitäten die Gesellschaft eher spalten oder einen, lässt sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Religion und Weltanschauung sind in diesem Zusammenhang vor allem ambivalente Grössen. Die genannte Umfrage zeigt, dass Religion als soziale Identitätskategorie – ebenso wie andere soziale Identitäten – sowohl trennende als auch ausschliessende Effekte entfalten kann. Befragte in beiden Ländern berichten von Diskriminierungserfahrungen, die sie aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit machen. Zugleich jedoch zeigen sie sich selbst bereit, Religion als Grenze sozialer Zugehörigkeit zu markieren – etwa durch die Ablehnung interreligiöser Eheschliessungen.
3. Erfahrungen religiöser Diskriminierung in Deutschland und der Schweiz
Religiös motivierte Diskriminierung wird sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz in einem moderaten Ausmass erlebt – allerdings betreffen diese Erfahrungen überdurchschnittlich häufig bestimmte religiöse Gruppen.
4. Ausschlussbereitschaft auf Grundlage religiös-weltanschaulicher Identität
Die Bereitschaft, die eigene religiös-weltanschauliche Identität als Kriterium sozialen Ausschlusses zu betrachten, ist relativ weit verbreitet. Etwa jede fünfte konfessionslose Person in beiden Ländern schliesst eine Ehe mit einer religiös gebundenen Person aus.
5. Religiös-fundamentalistische Vorrangansprüche gegenüber Verfassung und Demokratie
Ein ideologisch-fundamentalistischer Vorrang religiöser Normen gegenüber Verfassung und Demokratie ist selten. Die vorliegende Umfrage erhob auch Daten zur Frage, inwiefern die Befragten eine Trennlinie zwischen demokratischer Ordnung und religiöser Wahrheit ziehen. Konkret wurde gefragt: ob im Konfliktfall die Religion gegenüber der staatlichen Verfassung Vorrang haben sollte; ob die Religion bzw. Weltanschauung als letztgültige politische Autorität gilt; und ob man bereit sei, seine religiösen Überzeugungen notfalls auch mit Gewalt durchzusetzen. Grundsätzlich werden diese Vorstellungen von der überwältigenden Mehrheit in beiden Ländern abgelehnt. Ein religiöser Vorrang gegenüber der Verfassung wird insgesamt nur selten bejaht. Allerdings finden sich in allen religiösen Gemeinschaften kleinere Fraktionen, die eine oder mehrere dieser Aussagen bejahen.
Die relevante politische Problemstellung lässt sich wie folgt formulieren: Alle dogmatischen bzw. fundamentalistischen Haltungen sowie politisch extrem ausgerichtete Positionen sollten ernst genommen, im Dialog mit den jeweiligen Religionsgemeinschaften thematisiert und präventiv bearbeitet werden. Die Gründe dafür, dass solche Positionen unter den befragten Musliminnen und Muslimen häufiger auftreten als bei Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften, sind vielfältig. Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass es sich bei diesen politischen Extrempositionen nicht um ein substanzielles Problem des „Islam“ als Religion handelt.
6. Religion als Trägerin zivilgesellschaftlichen Engagements
Religion – sowohl auf der Ebene individueller Religiosität als auch auf der Ebene kollektiver religiöser Zugehörigkeit – fördert das freiwillige Engagement und damit auch die Zivilgesellschaft. Im Zentrum der Zivilgesellschaft, also jenem intermediären Bereich im öffentlichen Raum der gesellschaftlichen Selbstorganisation zwischen Staat, Wirtschaft, Kultur/Religion und privater Lebenssphäre, steht das bürgerschaftliche Engagement. Die vorliegende Studie zeigt: In beiden Ländern stellt Religion eine tragende Säule des freiwilligen Engagements dar. Religion wirkt dabei sowohl auf der strukturellen Ebene der Organisation zivilgesellschaftlicher Aktivitäten als auch auf der Ebene individueller Beteiligung als fördernder Faktor.
7. Religiöse Identität und interreligiöser Dialog
Für diejenigen, denen religiöse Identität wichtig ist, besitzt auch der interreligiöse Dialog einen hohen Stellenwert. Die Studie untersucht Religion als soziale Identitätskategorie nicht nur im Kontext der Zivilgesellschaft, sondern auch hinsichtlich ihrer förderlichen und stabilisierenden Dimensionen im soziopolitischen Sinne. Zwei zentrale Ergebnisse stechen dabei hervor: Erstens zeigt sich eine deutlich positive Korrelation zwischen der Bedeutung von Religion als sozialem Identitätsmerkmal und der Unterstützung für den interreligiösen Dialog. Für Personen, denen Religion besonders wichtig ist, hat auch der interreligiöse Austausch hohe Relevanz. In Deutschland trifft dies auf 66 % der Befragten zu, in der Schweiz auf 60 %. Diese Personen sind sich bewusst, dass religiöse Pluralität einen offenen Dialog und Austausch erfordert, um eine konstruktive Mittlerrolle im gesellschaftlichen Miteinander einzunehmen. Zweitens kommt die stärkste Unterstützung für den interreligiösen Dialog von religiösen Minderheiten – insbesondere von befragten Musliminnen und Muslimen. Hier liegt ein erhebliches Potenzial für einen breit angelegten gesellschaftlichen Dialog. Alle Mitglieder der Gesellschaft sind aufgerufen, dieses Potenzial ernst zu nehmen und es vor allem als integrativen Gestaltungsauftrag in einer pluralen Gesellschaft zu verstehen.
8. Breiter Konsens über Religionsfreiheit als Grundlage gesellschaftlichen Zusammenlebens
Es besteht ein breiter gesellschaftlicher Konsens, wenn es um die Bedeutung der Religionsfreiheit geht. Der in beiden Ländern festgestellte Dialogwille stützt sich auf eine nahezu allumfassende Übereinstimmung hinsichtlich des Werts der Religionsfreiheit für das friedliche Zusammenleben. Gerade dadurch kann religiöse Vielfalt zur Verbindung, zur Integration und zur Weiterentwicklung der Gesellschaft beitragen.
Eine besonders wertvolle Erkenntnis, die sich aus der ersten Auswertung dieser Studie ergibt, liegt im nachgewiesenen Zusammenhang religiöser Identität auf individueller wie auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Verschiebt man die Analyseebene vom Individuum bzw. der Gruppe hin zur makrosozialen Perspektive, so treten innerhalb der Vielfalt sozialer Identitäten in Deutschland und der Schweiz neue Regelmässigkeiten zutage. Diese Muster sind in beiden Ländern bemerkenswert ähnlich ausgeprägt.
9. Fünf Konfigurationen sozialer Identität in Deutschland und der Schweiz
In Deutschland und in der Schweiz lassen sich fünf Konfigurationen sozialer Identität identifizieren: die Zugehörigkeitsorientierten, die Umfeldorientierten, die Religionsorientierten, die Familienorientierten und die Selbstorientierten. Diese fünf Identitätskonfigurationen finden sich sowohl innerhalb aller religiösen Gemeinschaften als auch bei Personen ohne religiöse Zugehörigkeit – wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen im Detail. Wesentlich ist hierbei die Erkenntnis, dass keine religiöse Gemeinschaft eine homogene Struktur darstellt. Vielmehr partizipieren alle – in unterschiedlichem Masse – an einem pluralen gesellschaftlichen Umfeld. Die Identifikation dieser fünf Konfigurationstypen führt letztlich zu einem bemerkenswerten Befund auf makrosozialer Ebene.
10. Religion als strukturierende Grösse im gesellschaftlichen Identitätsgefüge
Religion als soziale Identitätskategorie wirkt auf gesamtgesellschaftlicher Ebene deutlich strukturierend auf alle fünf Konfigurationen sozialer Identität ein – auch wenn sie auf individueller Ebene in der subjektiven Rangordnung häufig hinter anderen Identitätsmerkmalen zurücktritt. Dies lässt sich als empirischer Bezugspunkt für das Konzept emergenter Eigenschaften sozialer Systeme deuten, wie es etwa in der Systemtheorie postuliert wird. Gesellschaftliche Phänomene entstehen demnach nicht bloss aus der summativen Aggregation individueller Merkmale (der befragten Personen), sondern beruhen auf Effekten, die erst im Zusammenspiel zahlreicher Einzelaspekte in Erscheinung treten – und die dadurch eine eigene Qualität und Bedeutung erhalten. Der strukturierende Einfluss von Religion auf die Konfiguration sozialer Identitäten auf der Makroebene ist somit als ein zentraler Befund mit klarer soziologischer Relevanz zu werten.Trotz des zunehmenden Komplexitätsgrads individueller Identitätskonstruktionen bleibt Religion in Deutschland und der Schweiz eine gesamtgesellschaftliche Grösse, die soziale Identitäten auf nachhaltige Weise mitstrukturiert.
Dies waren die zehn zentralen Befunde der empirischen Studie, deren Originalfassung unter dem in der Fussnote angegebenen Link eingesehen werden kann. [1]
Kritische Annäherung
Im Folgenden werde ich versuchen, einige ausgewählte Punkte durch eigene Beobachtungen zu ergänzen – gestützt sowohl auf einschlägige wissenschaftliche Arbeiten als auch auf meine persönlichen Erfahrungen als Imam, der seit 18 (mittlerweile 23) Jahren in der Schweiz lebt und wirkt.
Auch in dieser Studie wurde erneut die Bedeutung und das Gewicht der Religion bei der Strukturierung sozialer Identitäten bestätigt. Entgegen der oft vertretenen These, dass Religion im Zuge der Säkularisierung europäischer Gesellschaften aus dem öffentlichen Raum verdrängt und schliesslich vollständig verschwinden werde, zeigt sich die Realität deutlich anders: Religion bleibt weiterhin eine prägende und strukturierende Grösse – wenn auch zunehmend in individualisierter und personalisierter Form.
Zur Frage des sozialen Zusammenhalts im Lichte religiöser Deutung
Auch diese empirische Studie vermag auf die Frage, ob Religion den sozialen Zusammenhalt eher stärkt oder schwächt, keine eindeutige Antwort mit einem einfachen Ja oder Nein zu geben. Denn letztlich hängt dies entscheidend davon ab, wie wir die religiösen Texte lesen und wie wir Religion – mit ihren jeweiligen Lehren – verstehen. Starre und kontextlose Auslegungen jeglicher Religion, die historische und soziologische Entstehungszusammenhänge ausblenden, neigen dazu, Ideen von Überlegenheit, Wahrheitsmonopol und Exklusivität zu befördern. Solche Deutungen ziehen zwangsläufig Trennlinien, führen zu Abgrenzung und Isolation gegenüber anderen Religionen und Weltanschauungen. Ein reflektierter, kontextsensibler Zugang zur Religion dagegen macht deutlich, dass religiöse Traditionen – und mit ihnen auch ihre Gläubigen – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart in der Lage waren, gemeinsame Werte und Wege des Zusammenlebens zu finden, trotz theologischer Unterschiede. Beispiele für ein solches respektvolles Miteinander zwischen verschiedenen Religionen und ihren Anhängerinnen und Anhänger lassen sich insbesondere in der islamischen Welt – sowohl historisch als auch gegenwärtig – zahlreich finden. Die zentrale Frage lautet daher: Wie gehen wir mit unserer Religion um? Betrachten wir sie als Brücke zum Anderen oder als Bollwerk zur Abgrenzung, getragen von der Vorstellung, nur die eigene religiöse Gruppe sei „gerettet“? Letztere Sichtweise führt zwangsläufig zu inneren Ausgrenzungsmechanismen – selbst innerhalb der gleichen Religion, etwa zwischen verschiedenen Strömungen oder Konfessionen. Der Kreis jener, die sich im Besitz der alleinigen Wahrheit wähnen, wird dadurch immer enger. Aus meiner Sicht widerspricht diese exklusive Lesart dem göttlichen Willen. Ich bin überzeugt, dass Gott ein Zusammenleben im Respekt und in Anerkennung der von Ihm selbst geschaffenen Vielfalt gewollt hat – und weiterhin will.[2]
Doppelte Standards in der öffentlichen Rezeption religiöser Loyalitätskonflikte
Ein weiterer Befund dieser Studie, der in den Medien besonders hohe Wellen geschlagen hat, betrifft die Frage der Vorrangstellung religiöser Gebote gegenüber der staatlichen Verfassung im Falle eines Konflikts. Mit Nachdruck wurde in den Medien verbreitet, dass rund ein Drittel der muslimischen Befragten in Deutschland und der Schweiz nicht bereit sei, in Konfliktfällen die jeweilige Verfassung des Landes zu respektieren. Diese Darstellung wurde vielfach genutzt, um die Loyalität von Musliminnen und Muslimen gegenüber demokratischen Strukturen infrage zu stellen und eine vermeintlich generelle Ungehorsamkeit oder Ablehnung gegenüber dem Rechtsstaat zu betonen. Was jedoch nur am Rande – wenn überhaupt – erwähnt wurde, ist der zentrale Befund der Studie, dass nicht Musliminnen und Muslimen, sondern Angehörige freikirchlicher Gemeinden in dieser Frage deutlich stärker zur Vorrangstellung religiöser Werte neigen. In der Schweiz beispielsweise vertreten bis zu 50 % der Befragten aus freikirchlichen Milieus die Auffassung, dass im Konfliktfall die religiösen Lehren über der Verfassung stehen sollten. Diese Tatsache wird in der öffentlichen Diskussion kaum thematisiert, geschweige denn als potenzielles Risiko für gesellschaftliche Ordnung oder Stabilität problematisiert.Es ist daher schwer, in dieser selektiven Rezeption der Daten keine doppelten Standards zu erkennen – insbesondere dann, wenn Musliminnen und Muslime konsequent unter Generalverdacht gestellt werden, während vergleichbare oder gar deutlichere Positionen in anderen religiösen Milieus stillschweigend übergangen werden.
Einen Teil der Verantwortung für diese doppelte Massmessung sehe ich auch beim vorliegenden Forschungsprojekt selbst. Während christliche Befragte differenziert nach Katholiken, Reformierten und Angehörigen freikirchlicher Gemeinden erfasst wurden, erscheinen Musliminnen und Muslime in einer einheitlichen Kategorie – so, als handle es sich um eine homogene Gruppe. Diese Tendenz zur undifferenzierten Darstellung von Musliminnen und Muslimen, die historisch gewachsen ist, setzt sich somit auch in wissenschaftlichen Studien fort – ganz zu schweigen von der medialen und populistisch-politischen Instrumentalisierung solcher Bilder. Eine genauere Analyse der Studienergebnisse zeigt: Katholikinnen und Katholiken mit 11 % in Deutschland und 13 % in der Schweiz, evangelisch-reformierte Christinnen und Christen mit 11 % in Deutschland und 12 % in der Schweiz sowie Freikirchlerinnen und Freikirchlern mit 32 % in Deutschland und sogar 49 % in der Schweiz – all diese Gruppen zusammengenommen machen 54 % in Deutschland und 74 % in der Schweiz aus, die tendenziell religiöse Überzeugungen über die Verfassung stellen. Demgegenüber stehen 28 % der muslimischen Befragten in Deutschland und 23 % in der Schweiz, die diesen Vorrang bejahen. Obwohl die Autorinnen und Autoren der Studie den Befund relativieren, indem sie betonen, es handele sich um Randgruppen bzw. kleinere Fraktionen innerhalb der jeweiligen Religionsgemeinschaften, enthebt sie das nicht der Verantwortung für die strukturelle Reproduktion stereotyper Vorstellungen. Gerade im Kontext der seit dem 11. September 2001 intensivierten sicherheitspolitischen Debatten trägt auch die Wissenschaft – bewusst oder unbewusst – zur Verfestigung einseitiger Wahrnehmungen von Musliminnen und Muslimen als potenzielle „Problemgruppe“ bei.
Diese Vorgehensweise ist kritisch zu beurteilen. Denn die in der Studie vorgenommene heterogenisierte Darstellung der Christinnen und Christen (in Katholiken, Reformierte und Freikirchler) einerseits und die homogenisierte Kategorisierung der Musliminnen und Muslimen andererseits hat den Medien Raum gegeben, plakative und zugespitzte Schlagzeilen zu formulieren – wie etwa: „Religion schlägt Verfassung“, gefolgt vom Untertitel: „Eine Umfrage zeigt: Fast jeder vierte Muslim in der Schweiz hat antidemokratische Überzeugungen“. Solche medialen Narrative sind inzwischen zu einem bekannten Muster in der Berichterstattung der letzten Jahrzehnte in Deutschland und der Schweiz geworden. Sie reproduzieren eine selektive Wahrnehmung, in der muslimische Religiosität häufig pauschal mit Demokratiedistanz, Radikalität oder Gefährdung assoziiert wird – während vergleichbare Tendenzen in anderen religiösen Milieus kaum mediale Aufmerksamkeit erfahren.
In einer vor drei Jahren in der Schweiz durchgeführten Studie zur Berichterstattung der Printmedien über Musliminnen und Muslimen zeigt sich erneut ein deutliches Ungleichgewicht in der medialen Thematisierung: Themen, die sich auf die Lebensrealität der muslimischen Mehrheiten und ihren „Alltag“ beziehen, nehmen lediglich 2 % des gesamten medialen Diskurses ein; ebenso machen Berichte über „gelungene Integrationsbeispiele“ nur 2 % aus. Demgegenüber dominierten im Jahr 2017 die Themen „Radikalisierung“ und „Terror“, die zusammen 54 % der medialen Aufmerksamkeit auf sich zogen. Der Anteil der Artikel, deren Tonalität Distanz gegenüber muslimischen Akteurinnen und Akteuren erzeugt, ist im Untersuchungszeitraum signifikant angestiegen – von 22 % im Jahr 2009 auf 69 % im Jahr 2017. Diese Entwicklung lässt sich zum Teil durch eine zunehmende mediale Fokussierung auf Bedrohungsszenarien wie „Radikalisierung“, „Terror“ oder „gefährdete Integration“ erklären. Als Mittel gegen Radikalisierung wird vorrangig eine Verschärfung sicherheitspolitischer Massnahmen gefordert (17 %). Bemerkenswert ist dabei, dass die Argumentationsgrundlagen vielfach aus den Medien selbst stammen (41 %) – häufig unter Bezugnahme auf andere Medien, was auf eine zirkuläre Referenzlogik hinweist. Besonders deutlich wird die Tendenz zur distanzierenden Berichterstattung in bestimmten Medientiteln: In der Zeitschrift Weltwoche weisen 84 % der Artikel einen distanzierenden Tenor auf, in Boulevardmedien wie SonntagsBlick 63 % und Blick 59 %, in abonnentenbasierten Tageszeitungen wie der NZZ und Le Temps liegt der Anteil bei 31 %. Ein solcher distanzgenerierender Journalismus ist problematisch, insbesondere dann, wenn er mit pauschalisierenden Aussagen einhergeht. In der Berichterstattung über Musliminnen und Muslimen in der Schweiz bleiben die Betroffenen selbst weitgehend Objekt medialer Deutung: In 55 % der Artikel wird über sie gesprochen, ohne dass sie selbst zu Wort kommen; in weiteren 25 % erhalten sie nur am Rande eine Stimme. Und wo Musliminnen und Muslime tatsächlich zu Wort kommen, geschieht dies häufig in einem polarisierten Kontext: Mediale Aufmerksamkeit erhalten überwiegend exponierte Vertreterinnen mit extrem konservativen oder extrem liberalen Positionen.Vertreterinnen islamischer Organisationen, die den moderaten Teil der muslimischen Bevölkerung repräsentieren, finden dagegen kaum mediale Beachtung.[3]
Es ist offensichtlich, dass ein Extrem das jeweils andere bedingt: Im vorliegenden Fall begünstigt religiöser Extremismus die Entstehung von Islamfeindlichkeit – und umgekehrt. Extremismen nähren sich wechselseitig. Beide Seiten instrumentalisieren das jeweils andere Lager propagandistisch, um die eigene Erzählung zu plausibilisieren und ihren extremistischen Positionen sowie Handlungen Legitimität zu verleihen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Feststellung, dass Musliminnen und Muslime in Europa zwar gut in die gesellschaftlichen Strukturen integriert sind, jedoch von der Mehrheitsgesellschaft oft nicht in angemessener und würdevoller Weise anerkannt werden. Hierzu sei auf die Ergebnisse des Religionsmonitors 2017 der Bertelsmann Stiftung verwiesen, veröffentlicht unter dem Titel „Muslime in Europa – Integriert, aber nicht akzeptiert?“.[4]
An diesem Punkt geht es mir ausdrücklich nicht darum, apologetische Urteile zu formulieren oder verfassungswidrige, antidemokratische sowie religionsverzerrende Positionen radikaler oder fundamentalistischer Musliminnen und Muslime zu verteidigen. Vielmehr appelliere ich an die Stimme der Vernunft, gesellschaftliche Herausforderungen stets aus unterschiedlichen Perspektiven und in ihrer Mehrdimensionalität zu betrachten. Zugleich rufe ich dazu auf, dass alle – vom einzelnen Individuum bis hin zu den höchsten staatlichen Instanzen – Verantwortung für den gesellschaftlichen Frieden und die Stabilität im Land übernehmen. Jede und jeder sollte sich der eigenen Verantwortung bewusst sein, denn dieses Land und das Leben auf dieser Erde sind uns allen – gleich einer gemeinsamen Arche – als ein anvertrautes Gut von Gott übergeben worden.
Ein falscher Vergleich: Der Qur’an ist keine Verfassung
Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt ist die häufige und problematische Gleichsetzung heiliger Schriften mit staatlichen Verfassungen. Ich erinnere mich gut daran, dass im März 2012 eine Schweizer Zeitung ein Interview mit mir veröffentlichte – unter dem Titel: „Die Verfassung steht über dem Koran“. Menschen mit gesundem Menschenverstand innerhalb der muslimischen Community in der Schweiz sahen darin kein Problem, da sie den Kontext der Aussage und die dahinterstehende Problematik verstanden hatten. Ganz anders jedoch reagierten einige konservative und extremistische muslimische Einzelpersonen oder Gruppierungen, die die Welt ausschliesslich in Schwarz-Weiss-Kategorien betrachten – in „uns, die Guten“, und „die anderen, die Schlechten“. Sie zögerten nicht, mich als kāfir (Ungläubig) zu bezeichnen, mit der Begründung, ich hätte angeblich gesagt, die Verfassung der Schweiz stehe über dem Qur’an – also, ihrer Logik zufolge: das von Menschen gemachte Recht über das göttliche Gesetz. Zum einen habe ich mich nie in dieser Form geäussert – auch nicht im besagten Interview; die Formulierung stammte vom Journalisten oder der Redaktion und war ein Zitat, das mir untergeschoben wurde. Zum anderen bin ich überzeugt, dass der Qur’an als heilige Schrift eben keine Verfassung ist und nicht auf diesen Begriff reduziert werden darf. Ein solcher Vergleich wird der Würde des Qur’an nicht gerecht – er verkennt seine Grösse und verzerrt sein Wesen. Keiner der Namen, mit denen der Qur’an im Qur’an selbst benannt wird, ist dustūr (Verfassung). Vielmehr nennt ihn Gott: kitāb (Buch), haqq (Wahrheit), dhikr (Ermahnung), hudā (Wegweisung), shifā’ (Heilung) u. a. – aber niemals Verfassung. Der Begriff Verfassung als Beschreibung für den Qur’an ist allenfalls im übertragenen Sinne zulässig. Sicherlich können einzelne Prinzipien und Verse des Qur’an als Grundlage für die Formulierung einer oder mehrerer Verfassungen dienen – doch der Qur’an selbst ist keine. Dass sowohl Saudi-Arabien als auch Iran behaupten, ihre jeweiligen Staatsverfassungen auf den Qur’an zu stützen, obwohl diese grundlegend verschieden sind, zeigt deutlich, dass der Qur’an selbst nicht identisch mit irgendeiner staatlichen Verfassung ist. Da der Qur’an einige Rechtsvorschriften enthält, die mit der Schweizer Bundesverfassung und dem geltenden Strafrecht unvereinbar sind, können wir in der Schweiz nicht die Anwendung von Körperstrafen wie Handabhacken, Steinigung oder Auspeitschung fordern. Die Schweizer Verfassung garantiert gemäss Artikel 10 den Schutz der körperlichen und psychischen Unversehrtheit jedes Menschen – und das unter allen Umständen. In diesen Fragen gilt für uns das Recht des Landes, in dem wir leben. Schon in dem Moment, in dem wir ein Visum oder eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz beantragen, verpflichten wir uns de facto, nach den Gesetzen dieses Staates zu leben. Wenn wir also vom Qur’an als „Verfassung“ sprechen, dann darf dies nur im metaphorischen Sinne geschehen. Ein wörtlicher Vergleich zwischen dem Qur’an und einer staatlichen Verfassung führt in die Irre – denn es handelt sich dabei um zwei grundsätzlich verschiedene Texte: Der Qur’an ist eine heilige Schrift – keine Verfassung. Die Schweizer Bundesverfassung ist ein juristisches Dokument – kein heiliger Text. Es wäre ebenso unsinnig, den Qur’an mit einem Biologiebuch oder Chemielehrbuch zu vergleichen, wie es verfehlt ist, ihn einer staatlichen Verfassung gegenüberzustellen. Vergleichbar sind Bücher gleichen Typs: zwei Verfassungen miteinander, oder zwei Lehrbücher. Aber nicht eine Offenbarungsschrift mit einem Gesetzestext.
Ein kritischer Blick auf den Umgang mit dem Thema Gewalt
Der letzte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, betrifft die Thematik der Gewalt. Die besagte Studie stellt fest, dass 17 % der befragten Musliminnen und Muslimen in Deutschland und 8 % in der Schweiz bereit seien, Gewalt anzuwenden, um ihre religiösen Überzeugungen durchzusetzen. Auch hier fällt erneut der Unterschied in der Kategorisierung auf: Während Musliminnen und Muslime als homogene Gruppe dargestellt werden, erfolgt bei Christinnen und Christen eine Differenzierung nach Konfessionen. So werden katholische Christinnen und Christen mit 5 % in Deutschland und 3 % in der Schweiz, evangelisch-reformierte mit 2 % in Deutschland und 1 % in der Schweiz sowie Freikirchlerinnen und Freikirchlern ebenfalls mit 2 % bzw. 1 % ausgewiesen. Diese Gruppen zusammengenommen ergeben 14 % – ein Gesamtwert, der zwar niedriger ist als der der befragten Musliminnen und Muslimen (25 %), jedoch im Unterschied zu diesem nicht als einheitlicher Wert dargestellt wird. Ein weiterer Aspekt, der mich in diesem Zusammenhang besonders beschäftigt, betrifft die begriffliche Unschärfe des Gewaltbegriffs. Welche Art von Gewalt ist hier überhaupt gemeint?Handelt es sich um physische Gewalt? Und wenn ja – in welcher Form? Körperliche Übergriffe mit Fäusten, mit Hieb- oder Stichwaffen, mit Schusswaffen? Oder ist auch psychische, sexuelle, ökonomische oder soziale Gewalt gemeint? Die Studie bleibt an dieser Stelle eine präzisierende Definition schuldig – und überlässt damit der Interpretation (oder Fehlinterpretation) Tür und Tor. Anstatt zur sachlichen Aufklärung beizutragen, wird auf diese Weise Raum für Missverständnisse und mediale Ausschlachtung geschaffen.
Natürlich beschäftigt uns dieses heikle Thema zutiefst – uns Musliminnen und Muslime, die zur oft übersehenen „schweigenden Mehrheit“ gehören. Es stellt uns vor eine weitere Herausforderung: nämlich diese Problematik aktiv in unseren Predigten, Bildungsangeboten, Veröffentlichungen und Gesprächen mit unseren eigenen Gemeinden aufzugreifen. Dieser Verantwortung stellen wir uns bewusst. Wir – als Imame, Moscheevorstände, Leitende islamischer Organisationen u. a. – betrachten es als unsere Aufgabe, zu diesen Themen so viel Aufklärungsarbeit wie möglich zu leisten. Doch gerade in diesem Prozess sind wir auf die Unterstützung aller relevanten gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren angewiesen. Nur gemeinsam kann ein Klima des gegenseitigen Vertrauens, der Klarheit und des Zusammenhalts entstehen.
Kreuzlingen, 15.10.2020
[2] Siehe Qur’an: “Und wenn Allah wollte, hätte Er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber (es ist so,) damit Er euch in dem, was Er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach den guten Dingen!” (al-Maidah, 5:48)
[3] Vertiefend siehe: Ettinger, Patrik, Qualität der Berichterstattung über Muslime in der Schweiz, Hrsg. Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR), Bern, September 2018.

